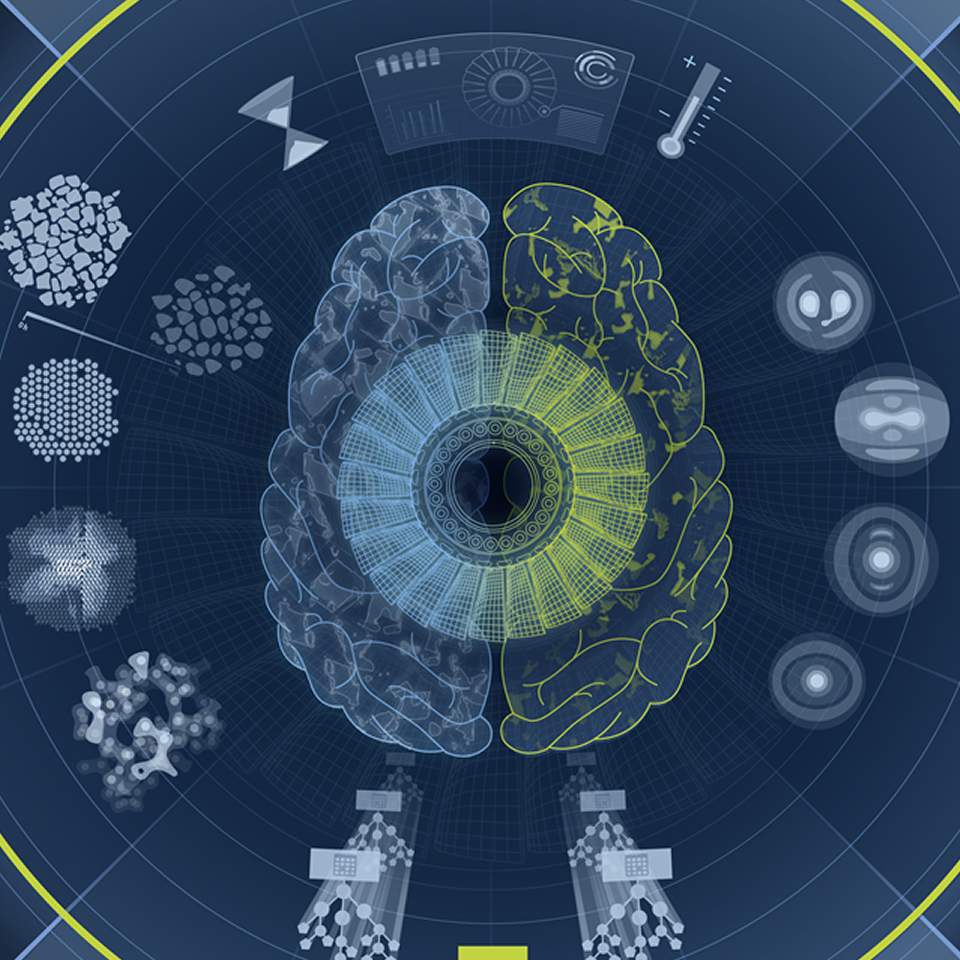In ihrem Vortrag wollen Sie ein »etwas anderes Verständnis von Industrie 4.0« präsentieren. Wie sieht das aus?
Rühl: Der Begriff »Industrie 4.0« bietet Spielraum. Vorrangig steht er für die Vernetzung der Produktion, um beispielsweise Prozesse beziehungsweise die gesamte Wertschöpfungskette zu optimieren. Denkbar wäre aber auch den Begriff weiter zu fassen, die Möglichkeit der individualisierten Massenfertigung. Vom Front End zu Hause in die digitale Fabrik. In der aktuell vorgestellten Nationalen Industriestrategie 2030 des BMWi wird gerade diese Interaktion als Game Changer diskutiert. Diese Veränderungen stehen fest.
Für mich kann diese nur bedeuten, auf Grundlage der Digitalisierung weitere Methoden zu schaffen, die helfen, schnell, aktiv und erfolgreich auf neue Anforderungen reagieren zu können, also flexible Prozesse und agiles Management zu ermöglichen. Kurzum es muss das erklärte Ziel eine Verknüpfung der digitalen Fabrik mit wirtschaftlichen Größen, idealerweise in Echtzeit, sein.
Was brauchen wir dazu, was wir noch nicht haben?
Rühl: Unternehmen müssen nicht nur ihre technischen Größen und Kennzahlen vom Material bis zum Prozess zusammenbringen, sondern eben auch ihre wirtschaftlichen Daten. Oftmals werden schlichtweg nur einzelne Kostenblöcke verglichen. Das erlaubt aber beispielsweise keine schnellen Serienangebote, in denen komplett neue Umformprozesse mit anderen Taktzeiten, anderem Raumbedarf, dem Einsatz neuer Verfahren etc. abgebildet werden müssen. Will man erfolgreich handeln und gestalten ist dies im internationalen Wettbewerb unabdingbar.
Was häufig fehlt ist die Durchgängigkeit des Entwicklungsprozesses. Verschaltet zu der materialbasierten Prozesssimulation muss parallel eine Kostensimulation laufen. Diese machen Firmen meistens nur mit ihren Standardprodukten, aber gerade bei neuen Produkten und Märkten lohnt sich das Durchspielen und die Prozesssimulation sollte dazu in der Ebene der unternehmensstrategischen Entscheidungen Einzug halten. In meinem Vortrag will ich veranschaulichen, wie Prozesse und Produkte am Beispiel der Metallumformung in digitalen Workflows ineinandergreifen können.
»Bei allen ungelösten technischen Fragen, welche Plattform, welche Standards, ist die Digitalisierung aber aus meinen Augen noch viel mehr ein Kultur- als ein Technik- oder Kostenproblem.«
Bis 2020 plant die deutsche Industrie jährliche Investitionen von 40 Mrd. Euro in Industrie 4.0 Anwendungen. Wird diese Durchgängigkeit nicht schon realisiert?
Rühl: Nein, nicht überall. Gerade kleinere Unternehmen scheuen den Aufwand. Eine materialbasierte Prozesssimulation alleine ist extrem teuer, die kann für einen Anwendungsfall alleine schon einmal sehr schnell im fünfstelligen Bereich liegen und das geht dann natürlich ebenfalls zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit.
Einige große Konzerne haben durchgängige materialbasierte Prozesssimulation schon im Haus, klar, aber das Methoden-Knowhow bleibt dort auch teilweise an Ressortgrenzen hängen bzw. ist es hier ggf. schwierig die simultane Kostensimulationen zu bewerkstelligen und die Resultate zu vereinen und kann somit vom Management nicht für das Zukunftsgeschäft herangezogen werden. Ich sehe an dieser Stelle gute Chancen für größere mittelständische Unternehmen, in denen der Draht der Einheiten zum Management eng ist. Um die Initialzündung hinzubekommen oder ggf. Initialkosten klar im Blick zu haben gibt es ja auch unterschiedlichste denkbare Varianten wie Ausgründungen oder Corporate Venturing. Global gesehen habe ich aber den Eindruck, dass andere Nationen hier schon weiter sind.
Wir haben in weiten Teilen noch die klassische Arbeitsteilung. Die Wissenschaft muss Erkenntnisse liefern, teilweise ohne Verwertungsanspruch. Wirtschaftsingenieure setzen Geschäftsmodelle um, aber greifen selten technische Neuerungen ab. Simulationen sind mittlerweile unglaublich effektiv geworden, aber finden hauptsächlich im Engineering Anwendung. Dabei liegen so viele wertvolle Daten vor, die nicht verknüpft werden. Da müssen wir noch mehr vom Innovationsglauben zum Evolutionsglauben und einer ganzheitlichen Draufsicht.
Wie könnten Lösungsansätze dahin aussehen?
Rühl: Ich sehe zwei Wege. Wir müssen zum einen diskutieren wie sehr wir den Transformationsprozess national steuern wollen, indem wir beispielsweise übergreifende Prozessdatenbanken aufbauen, um international konkurrenzfähig zu bleiben. Materialdatenbanken gibt es zwar bereits, aber auf dem bisherigen Level können wir damit nicht bestehen.
Zum anderen ist in Deutschland die interne Konkurrenz sehr hoch. Gesunder Wettbewerb ja, aber aus volkswirtschaftlicher Sicht, gerade mit den Herausforderungen mit denen wir uns konfrontiert sehen, als Firmen, als Land, EU braucht es eine Strategie. Hier würde es oft schon reichen wenn sich zwei oder drei Unternehmen zusammentun. Es gibt da erste Erfolgsprojekte. Im Maschinenbau haben sich beispielsweise Kooperationsmodelle zwischen anwendungsorientierter Forschung, Integratoren und Endanwendern bewährt. Die Kooperation funktioniert dort, eine verbindliche Zusammenarbeit eröffnet die Möglichkeit, attraktive Gesamtpakete anbieten zu können. Damit Firmen hier agil bleiben können, gerade der deutsche Mittelstand, muss da auf Verbands-, Bundes- und Community-Ebene aber noch Einiges passieren. Die Interdisziplinarität, die Fraunhofer auch mit dem MaterialDigital-Workshop anstrebt, ist genau das, wovon ich spreche und daher sehr wertvoll für die bevorstehenden Transformation der deutschen Industrie.
nach oben
 Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM
Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM